Karlsruhe3 (Verlag Versicherungswirtschaft), 2020; Preis: 34,00 Euro; 195 Seiten; ISBN: 978−3−96329−298−9
Wer in Deutschland gesetzlich krankenversichert ist, hat im Regelfall einen Anspruch auf ein Krankengeld ab dem 43. Tag einer durchgehenden Arbeitsunfhigkeit. Dieses betrgt maximal 70 Prozent des vorherigen Bruttoeinkommens, maximal jedoch 90 Prozent des letzten Nettoeinkommens. Dabei kann es speziell bei Gutverdienern durchaus zu einer erheblichen Versorgungslcke zwischen dem bisherigen Nettoeinkommen und dem Krankengeld nach Steuern kommen. Nicht jeder privat Krankenversicherte hat berhaupt einen Anspruch auf Krankentagegeld. Gerade fr Selbststndige besteht seit dem 01.01.2009 keine Verpflichtung mehr, eine entsprechende Erweiterung ihres Versicherungsschutzes zu vereinbaren (S. 4 – 5).

Zielgruppe sind jene, die die Nettolcke schlieen wollen
Um diese Lcke zu schlieen, bietet die Versicherungswirtschaft Krankentagegeldversicherungen an. Voraussetzung fr den Leistungsanspruch ist das Vorliegen einer bedingungsseitigen Arbeitsunfhigkeit. Markus Sauer geht diesem Thema nach und bercksichtigt dabei die magebliche Rechtsprechung, mit der sich deutsche Gerichte hierbei auseinandersetzen mussten (S. 2). Dabei wird auch auf aktuelle Besonderheiten wie das Zusammentreffen mit ffentlich-rechtlichem Verdienstausfall wegen Quarantne im Zusammenhang mit den Manahmen im Rahmen der Corona-Pandemie eingegangen. Sauer schreibt hierzu unter anderem:
Versicherte knnen Quarantnemanahmen nach 30 IfSG oder beruflichen Ttigkeitsverboten nach 31 IfSG unterliegen. Aus diesen Manahmen entstehen i.d.R. Entschdigungsansprche des Verpflichteten gegen sein Bundesland, 56 Abs. 1 und Abs. 7 IfSG. [] Unternehmen, die sich entscheiden, ihren Versicherten schnell zu helfen und sie nicht auf die Leistungen nach dem IfSG zu verweisen, knnen sich gegen den Rckgriff durch das Bundesland zumindest teilweise absichern, in dem sie von den Versicherten die Erklrung verlangen, sie von im Wege des Rckgriffs geltend gemachten Forderungen des Bundeslandes in Hhe der geleisteten Krankentagegeldzahlungen freizustellen. (S. 3 – 4)
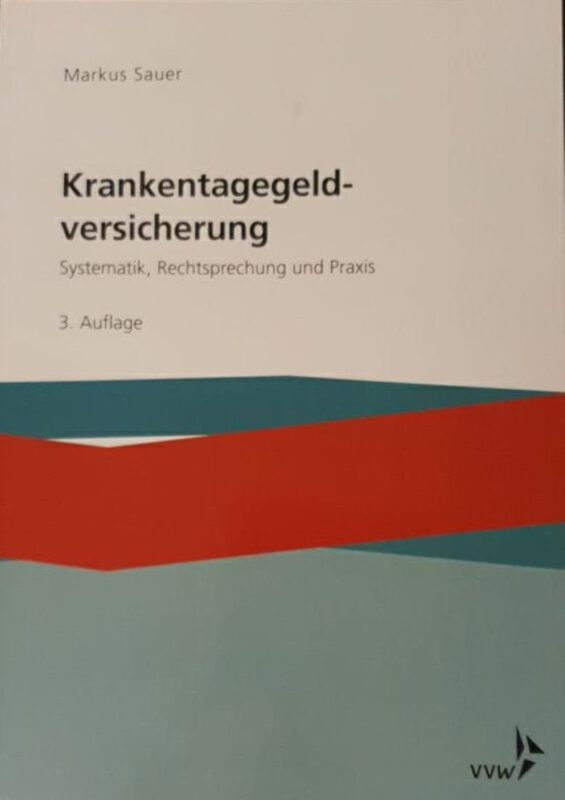
Versicherungsanspruch auf Krankentagegeldversicherung als Sonderfall
Interessant ist auch die Auseinandersetzung des Autors mit dem Thema Krankentagegeld aus dem Basistarif, da sich der gesetzliche Kontrahierungszwang hier auch auf das Krankentagegeld bezieht (S. 5).
Lange Zeit war strittig, ob die Krankentagegeldversicherung als Summen- oder als Schadenversicherung anzusehen sei. Mit Urteil aus 2001 entschied der BGH, dass sie als Summenversicherung anzusehen sei, was praktisch bedeutet, dass die vereinbarte Leistungshhe auch ber dem zum Schadenzeitpunkt aktuellen Nettoeinkommen der vergangenen 12 Monate liegen knne. Sauer begrndet, weshalb er diese Entscheidung fr nicht zwingend hlt. Aus dem Urteil ergbe sich auch die fehlende Regressmglichkeit nach 86 VVG (S. 6 – 7).
Vorstzliche Pflichtverletzung kann den Versicherungsschutz gefhrden
Der Autor geht auf mehreren Seiten auf die Verletzung vorvertraglicher Anzeigepflichten durch leichte bzw. grobe Fahrlssigkeit im Rahmen der Antragsstellung ein. Ebenso bercksichtigt er die Einrede der arglistigen Tuschung des Versicherers sowie schuldlose Anzeigepflichtverletzungen von Seiten des Versicherungsnehmers nach 194 Abs. 2 Satz 3 VVG (S. 10 – 13).
Ist ein Vertrag wirksam zustande gekommen, so knnen Leistungsansprche gegen den Versicherer nur dann erhoben werden, wenn der Beginn einer bedingungsseitig definierten Arbeitsunfhigkeit nachgewiesen werden. Hierfr fhrt der Autor auf, dass der Leistungsfall die Feststellung einer Arbeitsunfhigkeit durch einen approbierten Arzt bedarf, wodurch ein angestellter Arzt eines Medizinischen Versorgungszentrums nicht in Frage komme (S. 15). Weitere Voraussetzung ist die Behandlung einer Arbeitsunfhigkeit nach Ablauf der vereinbarten Karenzzeit. Dabei beachtet der Autor auch die Probleme, die durch eine rztlich vor dem Ausstellungsdatum der Bescheinigung diagnostizierte Arbeitsunfhigkeit resultieren knnen.
Der Versicherungsfall endet, wenn nach medizinischem Befind keine Arbeitsunfhigkeit und keine Behandlungsbedrftigkeit mehr bestehen. Das Ende des Versicherungsfalls fllt also nicht notwendigerweise mit dem Ende der Leistungspflicht des Versicherers zusammen, da Arbeitsunfhigkeit und Behandlungsbedrftigkeit zu verschiedenen Zeitpunkten enden knnen. (S. 16)
Sehr ausfhrlich geht Sauer auf das Mutterschaftsgeld ein, wie er das Krankentagegeld whrend der Mutterschutzfristen und am Entbindungstag tituliert, dabei bercksichtigt er auch durch unterschiedliche Karenzzeiten aufgeworfene Probleme, die Anrechnung von Elterngeld und Mutterschaftsgeld zu Lasten des Bundes sowie die Anwendbarkeit mgliche Leistungsansprche vor dem Hintergrund, dass es sich bei einer Schwangerschaft um keine Krankheit handelt (S. 18 – 26).
Gerade bei Selbststndigen und Freiberuflern im Home-Office stellt sich oft die Frage, ob eine bedingungsseitig geforderte 100%ige Arbeitsunfhigkeit berhaupt vorliegen kann.
So drfte z.B. der Einwand, dass das Fhren von Telefongesprchen als unbedeutender Teil zur beruflichen Ttigkeit gehre, der Versicherte aber durch seine telefonische Anzeige der Arbeitsunfhigkeit gezeigt habe, dass ihm dieser Teil noch mglich sei, fr die meisten Berufsbilder auerhalb einer zulssigen Auslegung des Begriffs der vlligen Arbeitsunfhigkeit liegen. (S. 30)
Isolierte Ttigkeiten mssen Sinn ergeben
Auch der BGH war bereits 2013 auf eine sozialadquate Betrachtung bei der Bewertung einer vollstndigen Arbeitsunfhigkeit eingegangen (BGH NJW 2013, 2121). Analog zur Berufsunfhigkeitsversicherung komme es nicht nur im damals verhandelten Fall eines Rechtsanwaltes, der nach einem Schlaganfall an Dyslexie (Leseschwche) erkrankten Rechtsanwaltes, sondern auch bei blicherweise Mitarbeiter beaufsichtigenden Selbststndigen auf die konkrete Ausgestaltung der beruflichen Ttigkeit in gesunden Tagen an (S. 30 – 31). Hierzu fhrt Sauer diverse Beispiele aus der Rechtsprechung an und bercksichtigt auch Arbeitsunfhigkeit infolge von Mobbing (S. 32 – 34).
Wer an eine mgliche Umorganisation des Betriebes von Selbststndigen denkt, hat meist zunchst die Berufsunfhigkeitsversicherung im Kopf, doch auch hier bercksichtigt der Autor die zur Krankentagegeldversicherung ergangene Rechtsprechung (S. 35).
Ganz geringfgige Arbeitsversuche unschdlich
Wann genau eine Arbeitsunfhigkeit endet, wird nicht immer einfach zu beantworten sein, zumal eine solche durchgngig an jedem einzelnen Tag des Krankentagegeldbezuges bestehen muss (S. 36). Dabei geht Sauer auch auf Arbeitsversuche ein, die dem Zweck dienen, wieder zurck ins Arbeitsleben zu finden (S. 37). Auch Umschulungsmanahmen, eine (versuchte) Wiedereingliederung bzw. die Aufnahme einer gnzlich anderen Erwerbsttigkeit erhalten seine Beachtung (S. 38 – 41).
Kapitel V geht sehr umfangreich auf die verschiedenen Obliegenheiten im Zusammenhang mit der Krankentagegeldversicherung ein (S. 43 – 81). In diesem Zusammenhang wird unter anderem auf ein Urteil des OLG Dsseldorf (r+s 1997, 299) eingegangen, wonach ein Versicherer nicht seine Leistungspflicht gegenber dem Versicherten abschlieend ablehnen drfe, um sich dann spter auf einen regelmigen Nachweis der fortbestehenden Arbeitsunfhigkeit zu berufen (S. 55).
Nur schmerzfreie und gefahrlose Operationen knnten in Frage kommen
Ebenfalls Beachtung findet die Verpflichtung der versicherten Person, sich um eine Wiederherstellung ihrer Arbeitsfhigkeit zu bemhen. Dabei stellt sich die berechtigte Frage, ob damit eine Pflicht verbunden ist, sich zwecks Schadenminderung nach 254 BGB einer Operation zu unterziehen. Hierbei stellt Sauer berechtigte Vergleiche zur Rechtsprechung im Zusammenhang mit der Berufsunfhigkeitsversicherung an (S. 69 – 70).
Gerade vor dem Hintergrund der Coronakrise von Interesse sind auch mgliche Obliegenheiten nach 9 Abs. 5 MB/KT im Zusammenhang mit einem schleichenden Berufswechsel, der Aufnahme eines Zweitberufs oder gar vollstndigen Berufswechsel (S. 70 – 73). Dabei bercksichtigt Sauer an einer spteren Stelle seines Buches auch eine mgliche Beendigung der Versicherbarkeit durch den Wechsel der versicherten Person z.B. in einen nach den Annahmerichtlinien des Versicherers nicht versicherbaren Beruf, eine (vorbergehende) Arbeitslosigkeit eines Angestellten, die Berufsaufgabe eines Selbststndigen oder den Bezug von Leistungen als Hartz-IV-Aufstocker (S. 131 137).
Bereits im Jahre 2002 hatte der BGH entschieden, dass kein Wegfall der Versicherungsfhigkeit vorliegt, wenn die berufliche Ttigkeit (z.B. Arbeitslosigkeit, Gewerbeabmeldung) whrend der Arbeitsunfhigkeit endet. (S. 134)
Definition des zugrunde liegenden Einkommens oft intransparent
Kapitel VI geht auf die versicherte Hhe des Leistungsumfangs ein. Zunchst einmal ist eine Abhngigkeit von Nettoeinkommen und versicherbarem Krankentagegeld festzuhalten (S. 83). Dabei unterscheidet Sauer zwischen der Berechnung des versicherbaren Tagessatzes nach den aktuellen MB/KT bei Angestellten und Selbststndigen (S. 84 – 86). Um Transparenz- und Berechnungsschwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, empfiehlt Sauer:
Die geschilderten Schwierigkeiten knnten vermieden werde, wenn zu Beginn des Versicherungsvertrags zwischen dessen Parteien geklrt wrde, wie sich fr die die konkrete berufliche Ttigkeit der versicherten Person das Nettoeinkommen berechnen soll. (. 87)
Gerade, wenn gewerbliche Einknfte mit Einknften aus einer nicht selbststndigen Ttigkeit zusammenfallen, ist eine entsprechende Klrung im Vorfeld dringend angeraten.
Nicht alles ist versicherbar
Immer wieder Streitigkeiten entstehen bei der Anwendung des 4 Abs. 9 MB/KT bei Behandlung einer versicherten Person in einer so genannten gemischten Anstalt. Grundstzlich sehen die Versicherer ihre Leistungspflicht an eine vorherige Zusage geknpft, gleichzeitig jedoch, soll der Versicherte stets um eine mglichst schnelle Wiederherstellung seiner Arbeitsfhigkeit bemht sein. Dieser mgliche Widerspruch war bereits Thema gerichtlicher Auseinandersetzungen (S. 101 – 102).
Auch andere Leistungsausschlsse verdienen Sauers Beachtung, so z.B. die Wohnsitzklausel nach 5 Abs. 1 f) unter Bercksichtigung eines gewhnlichen, dauerhaften oder vorbergehenden Aufenthaltes auerhalb des Geltungsbereiches des Versicherungsvertrages (S. 106 – 107).
In diversen Schulungen und Fachbeitrgen wird die Unterscheidung zwischen dem Begriff der Arbeitsunfhigkeit im Rahmen der Krankentagegeld- in Abgrenzung zur Berufsunfhigkeitsversicherung thematisiert. Auf die daraus resultierenden Probleme geht auch Sauer ein (S. 109 – 118). So kann es etwa dazu kommen, dass der Krankentagegeldversicherer seine Leistungspflicht deshalb verweigert, weil eine parallel dazu bestehende Berufsunfhigkeitsversicherung eintrittspflichtig wre. Problematisch ist es auch, wann die Fiktion einer voraussichtlich dauernd bestehenden Berufsunfhigkeit erfllt ist (siehe BGH VersR 2010, 1171, 1173).
Anwartschaftsversicherung kann angeraten sein
Bercksichtigung findet der Fall, wenn die Beendigung der Krankentagegeldversicherung dann erklrt werden soll, wenn eine Berufs- oder Erwerbsunfhigkeitsrente konkret bezogen wird. Die Wirksamkeit solcher Regelungen setze voraus, dass der Versicherer eine Anwartschaftsversicherung fr den Wegfall der bedingungsgemen Berufsunfhigkeit konkret angeboten hat. Dargestellt wird von Sauer der Fall, wonach eine versicherte Person gleichzeitig Anspruch auf Leistungen einer Krankentagegeld- sowie einer Berufsunfhigkeitsversicherung hat (S. 125 – 126). Besonderheiten im Einzelfall sind auch ein Leistungsanspruch aus einer Loss-of-License-Versicherung (S. 127 – 128) oder die Rckforderung von Krankentagegeld wegen des Bezugs einer Berufsunfhigkeitsrente (S. 128 – 130),
In Kapitel IX geht Sauer auf das Erreichen der Altersrente und den damit einhergehenden grundstzlichen Wegfall des Anspruches auf Leistungen aus der Krankentagegeldversicherung ein. Dabei verdient auch der allmhliche bertritt in das Rentnerleben nach dem 2017 in Kraft getretenen Flexirenten Gesetz seine Beachtung. Hier knnte etwa eine Reduzierung des Krankentagegeldes eine adquate Lsung sein, um dem zwar vorhandenen, aber reduzierten Einkommen gerecht zu werden (S. 119 – 121).
Kapitel XIII betrachtet die Beratungspflichten des Versicherers, wozu etwa die Empfehlung zum Abschluss einer Anwartschaftsversicherung nach Eintritt von Berufsunfhigkeit zhlen knnte (S. 141). Es fehlt jedoch ein eigenstndiges Kapital zu den Beratungspflichten des Versicherungsvermittlers.
DSGVO findet keine Bercksichtigung
Groen Raum nehmen die Kndigungsrechte des Vertrages durch den Versicherer sowie den Versicherungsnehmer ein (S. 143 – 153). Daran anschlieend geht Sauer auf prozessuale Themen wie die Bestimmung des Streitwertes bei Rechtsstreitigkeiten ein (S. 155 – 165).
Aktuelle Themen, die betrachtet werden, sind neben dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz (S. 103 – 104) auch der aktuelle Umgang mit personenbezogenen Gesundheitsdaten (S. 167 – 169), nicht jedoch die an dieser Stelle auch erwartete Bercksichtigung der DSGVO. Auch wird zwar auf das Beitragsanpassungsrecht des Krankenversicherers eingegangen (S. 173), lediglich am Rande jedoch auf die aktuelle Rechtsprechung im Zusammenhang mit dem so genannten Treuhnderstreit.
Das Buch wird abgerundet durch den Abdruck der Musterbedingungen mit Stand Januar 2018.
Fazit: Es fllt immer wieder positiv auf, dass Sauer ergangene Rechtsprechung durchaus kritisch hinterfragt, so z.B. auf S. 8 zur steuerlichen Bercksichtigung, auf S. 14 zur gerichtlichen Bewertung einer myotonen Dystropie vor dem Hintergrund des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes oder auf S. 56 im Zusammenhang mit einer vom Versicherer mitverschuldeten Obliegenheitsverletzung. Nicht selbstverstndlich ist auch das sehr umfangreiche Stichwortverzeichnis.
Insgesamt handelt es sich um eine sehr umfassende Zusammenfassung des Themas, das fr jeden Vermittler ebenso wie fr mit der Materie befasste Juristen einen sehr guten berblick bietet und entsprechend empfehlen ist.
